Tagungsbericht: 50th Annual Meeting der Society for the History of Technology, 11.–14. Oktober 2008 in Lissabon
[alle Session- und Paperabstracts sind unter
-> conference schedule abrufbar]
Ein Panel am Sonntagmorgen trug den versöhnlichen Titel
„Religion in Harmony with Technology“, der Berichtende nahm jedoch an der Session
„History and Energy Policy: A Role for Historians of Technology“, organisiert von
Richard Hirsh (Dept. of History, Virginia Tech) teil. Übergeordnetes Thema des Blocks war die Politikberatungsfunktion von TechnikhistorikerInnen, da die Rolle von Technikgeschichtserzählungen für das Verständnis von aktuellen Ereignissen weitgehend unterschätzt werde, wie Hirsh betonte.
Sara Pritchard (Dept. of STS, Cornell University) eröffnete das Panel, indem sie auf das generelle Potential des Begriffs „Energie” verwies, unterschiedlichste Diskurse, wie etwa zu den Themen „Umwelt“, „Ölkrise“ oder „Technik“ unter einem Dach zu vereinen. Ihr paper wählt dabei einen
envirotechnical approach, der historische Erkenntnisse über die Technik und ihre Vor- und Nachteile bei der Generierung von Energie, z. B. bei der Aufdeckung versteckter Kosten, miteinbezieht. Gerade TechnikhistorikerInnen müssten diese Kompetenzen nutzen, aus dem „Elfenbeinturm“ heraustreten und ihr Wissen in die „real world“ einbringen, so Richard F. Hirshs Plädoyer.
David E. Nye (Center for American Studies, University of Southern Denmark, Odense), Autor von „Electrifying America“, offerierte in seinem Vortrag
“Blackouts: Social Behavior during ‘Artificial Darkness’” eine originelle Sicht auf Stromausfälle, die er in folgendem Satz zusammenfasste: „There is no blackout, there is only no electricity.“ In kulturhistorischer Perspektive auf das Thema untersuchte er an Hand von Presse- und anderen schriftlichen Quellen die jeweiligen Reaktionen der Bevölkerung auf vier größere Stromausfälle in New York zwischen 1936 und 2003. Unter Einbeziehung des Foucault’schen Konzepts der „Heterotopie“ interpretierte er die unterschiedlichen Reaktionen – „ranged from resignation to partying, looting, and solidarity“ – als jeweils ihre Zeit reflektierend. So kursierten im Zusammenhang mit dem ‚blackout’ 2003 sofort Terrorismusgerüchte (die noch unter dem Eindruck von 9/11 standen und sich als unwahr herausstellten), und es wurde eine größere Solidarität unter den New YorkerInnen beobachtet. Der beschleunigte Kapitalismus, der durch die zunehmend angewandten IuK-Technologien so abhängig wie noch nie von Elektrizität ist, diente dabei als Kontrastfolie des „euphorischen“ Moments, der die Stadt zu einer anderen Landschaft machte: erst in der Zeitlosigkeit des entschleunigten heterotopischen Moments konnten nichtmonetäre Werte überhaupt erscheinen.
Leo Marx (Prof. em., STS-Programm am MIT), Verfasser des einflussreichen Buches
„The Machine in the Garden“ (1964) und Begründer der
american studies, erinnerte in seinem Session-Kommentar daran, dass heutige Studien, wie die Envirotech-Forschung, auch 150 Jahre später nicht vergessen dürften, dass es schon im 19. Jh. Ansätze gab, Technik zu verstehen, indem moderne Technologien mit der Umwelt in Verbindung gebracht wurden. Damals war ein (Literatur-)Diskurs entstanden (hier zitiert er in
The Machine ... die großen (Natur-) Schriftsteller, der Technik als Eindringling in der unberührten Natur des amerikanischen Kontinents interpretierte. Doch die Technik komme nicht von selbst in die Natur, dementprechend sein Fazit: „We are still obsessed with […] technological determinism.“
Vor diesem Hintergrund konnte die darauffolgende Session
„New Approaches and Tools I“ mit besonderer Spannung erwartet werden.
Trevor Pinch (Dept. Of Sociology, Cornell University) und Mitverfasser (und -herausgeber, zusammen mit Wiebe Bijker und Thomas P. Hughes) des STS-Klassikers
„The Social Construction of Technological Systems“ (1987) behandelte in seinem Vortrag die Rolle von „unsichtbaren Technologien“ für unser Verständnis von aktuellen (sehr sichtbaren) Technologien, wie dem so genannten „
Web 2.0“. In seinem Vortrag „The Invisible Technologies of Goffman’s Sociology: From the Merry-Go-Round to the Internet“ integrierte Pinch die Theorie der sozialen Interaktion in seine Überlegungen zur technisch vermittelten Interaktion (technological mediated interaction). Goffman hatte die soziale Welt (social life) – mit dem Vokabular des Theaters – als Drama beschrieben, in der es eine Vorder- und eine Hinterbühne gibt und die Menschen Darsteller ihrer selbst sind. Der Techniksoziologe sieht die menschlichen Interaktionen (dargestellt an Goffmans Restaurant-Beispiel) in ein technisches Setting eingebettet, die unsichtbaren Technologien. Pinch geht von einem weiten Technikbegriff aus; technology erfasst auch Fähigkeiten, wie z. B. den Umgang mit Tieren (ein weiteres Beispiel der „unsichtbaren Technologien“ sind bei ihm Pferde im Kriegseinsatz, neben moderner Kriegstechnik). Dementsprechend bilden in seinem Gedankengang Wände, Korridore, vor allem aber die Schwingtür zwischen Vorderbühne (Restaurant) und Hinterbühne (Küche), die Technologien, die die Bewegung zwischen den verschiedenen Rollen und Bühnen ermöglichen. Das Framework der technisch vermittelten Interaktion führte er sodann an Hand seiner aktuellen Untersuchungen zur webbasierten Kommunikation zwischen Musikfans auf der Online-Plattform Acidplanet.com aus. Sein Fazit verwies auf die Anfangsthese: Theorien der sozialen Interaktion können und sollten für die Analyse von Technik fruchtbar gemacht werden, um die Interaktionen der Nutzer/innen – auch ihre Rolle als „agents of technological change“ – besser zu verstehen.
Die Sessions des frühen Sonntagnachmittags
„New Approaches and Tools II“ und
„Owning and Disowning Invention“ liefen leider parallel, sodass hier nur jeweils nur ein unvollständiger Eindruck gewonnen werden konnte. Während das erste Panel zu den „New Approaches and Tools“ noch überzeugende Ansätze zur Integration sozial- und kulturwissenschaftlicher Modelle für die Technikanalyse lieferte, wurde im zweiten Themenblock (moderiert von
Wiebe E. Bijker, Dept. of Technology & Society Studies, Universiteit Maastricht) deutlich, dass Forschungen in frühen Entwicklungsphasen auch viele offene Fragen aufwerfen können.
Nina E. Lerman (Dept. of History, Whitman College, WA) legte in ihrem Paper (
“Apprenticeship Industrialized: Technological Knowledge from Household to Shopfloor”) an Hand historischer Lehrlingsbücher und anderer Archivalien dar, dass die Strukturen der Lehrlingausbildung („hands-on“, paternalistische Rollenverteilung) in den USA des späten 18./ frühen 19 Jhs. von den Lehrlingen übernommen wurden und das das damit von späteren Generationen reproduzierte Bild von adulthood bis in die Zeit der Industrialisierung trug. In seinem Kommentar bemerkte Bart Hacker (Kurator,
Nat. Museum of American History, Smithsonian Institution) dazu, dass Ausbildung (apprenticeship) nicht die einzige Praxis (practice) der Weitergabe von Wissensbeständen gewesen sei.
Andreas Stascheit (FB Angewandte Sozialwissenschaften, Fachhochschule Dortmund), stellte in seinem Vortrag
„History of technology as history of experience: the case of sound transformation“ die These auf, dass das High-Fidelity-Prinzip (möglichst originalgetreue Klangwiedergabe), sich durch die Hörerfahrung umgekehrt habe: Klangreproduktionen müssen heute so klingen, wie die „Originalaufnahme“. Diese These entwickelte er an einem komplexen phänomenologischen Theoriegebäude um den Begriff der Erfahrung, was im Plenum die Fragen aufwarf, ob die Fülle von Klangerfahrungen hier nicht willkürlich reduziert werde: auch wenn Britney-Spears-Fans oder ein an modernen Klassikeinspielungen („Anna Netrebko“) interessiertes Publikum beim Konzertbesuch CD-Qualität hören wolle, gelte dies für Freunde der historischen Aufführungspraxis noch lange nicht. Auch bliebe bei der Analyse der Klangaufzeichnung die Parallele zu einer anderen Technologie des 19. Jhs. unberücksichtigt – auch die sedimentierten Erfahrungen im Umgang mit der Fotografie dürften nicht vergessen werden.
Das Parallelpanel
„Owning and Disowning Invention: Intellectual Property and Identity in British Science and Technology, 1880–1920” untersuchte in historischer Perspektive, welche Beziehungen zwischen der Entwicklung des Britischen Patent-Systems und wichtigen Innovationen, den „fields of electrical engineering, aviation and plant breeding“, bestanden. Das Panel spiegelte aktuelle interdisziplinäre Diskussionen wider, die bei der Betrachtung neuer inventions rechtliche Rahmenbedingungen mitberücksichtigen, wobei davon ausgegangen wird, dass es – zumindest wenn ein I.P.-Regime funktioniert – der Schutz von intellektuellem Eigentum der Hervorbringung von Innovationen förderlich sei.
Mit dem Thema der Rolle des Intellectual Property (I.P.) bei der Entstehung von Innovationen beschäftigte sich vertiefend auch Session 26,
„The ‚Strong Patent System’ Story vs. the History of Technology“. In seinem abstract fasste Organisator
Bryan Pfaffenberger (STS-Dept., School of Engineering and Applied Science, University of Virginia) noch einmal die „große Erzählung des amerikanischen Strong Patent Systems“ zusammen – unbeachtet von den TechnikhistorikerInnen haben Ökonomen und Wirtschaftshistoriker durch die Auswertung großer Patentdatensätze herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem starken, von Innovationen geprägten Wachstum in den USA im 19. Jh. und dem einzigartigen U.S.-Patentrecht gebe. Dieses zeichne sich durch eine vorteilhaft ausgewogene Beachtung von open access und dem Schutz geistigen Eigentums aus. Innerhalb dieses Diskurses müsse die Technikhistorik ihre Deutungshoheit über die Interpretation des technological past zurückgewinnen, indem nicht mehr nur Einzelfallstudien spezielle Themen untersuchten, sondern durch die Auswertung größerer Datenbestände und die Anwendung neuer Methoden auch generalisierende Aussagen getroffen werden könnten. Wie genau also könnten TechnikhistorikerInnen auf die (methodischen) Herausforderungen der cliometrics reagieren? „The question […] is this: Can historians of technology discover more efficient ways to place large numbers of patents in context – and, in so doing, retell the patent story in new and critical ways that are consistent with our commitment to scholarship?”
Einen ersten Zugang entwickelte hier
Paul Israel (Dept. of History, Rutgers University, NJ), der in seinem Vortrag (
Learning from Thomas Edison’s patents) darlegte, dass Edison, der in der Patent-Erzählung wegen der Vielzahl seiner Patente eine herausgehobene Stellung einnimmt, nicht immer aus Erfindergeist oder persönlicher Motivation gehandelt habe. Ausgangsfrage war, warum sich eigentlich so viele Patente im Bereich der Telegrafie mit der (Weiter-) Entwicklung von Telegrafenkomponenten beschäftigten, wenige sich jedoch um die Datenintensität bemühten. An Hand von Patentakten und Briefwechseln gelang es Israel nachzuweisen, dass der Erfinder in engem Kontakt mit Mitarbeitern der Western Union Telegraph Company stand, die bei ihm technische Variationen regelrecht „bestellten“, um das Monopol über das Telegrafenpatent zu behalten. Das Patentrecht, welches das I.P. schützen und seinen Urheber am Erfolg teilhaben lassen sollte, wurde von Erfindern und (ihren) Unternehmen also auch gezielt genutzt, um den Marktzugang für Wettbewerber zu erschweren und Marketingstrategien (Monopol über die Distribution) umzusetzen.
Auch die Papers von Pfaffenberger selbst (zur amerikanischen voting machine industry, 1889–1925) und
Alessandro Nuvolari (Dept. of Technology Mgmt., Eindhoven University of Technology;
„Quackery, patents and the market for medicines in England, 1617–1852“) beschäftigten sich mit Fragen der Auswirkungen des Patentrechts auf technischen Wandel und bezogen dabei quantitative Datenanalysen mit ein.
Diese einheitliche Fragerichtung forderte die Session-Kommentatorin
Eda Kranakis (Dept. of History, University of Ottawa), die auch schon den Kommentar zur vorhergehenden Session geliefert hatte, zur Feststellung heraus, dass die hier skizzierten Überlegungen zum Patentrecht noch einmal überdacht werden müssten: Patentrecht diene eben nicht Innovationen, sondern in erster Linie Ansprüchen (claims). Kranakis, die sich in einem im Fach beachteten Artikel erst kürzlich mit dem Thema auseinandergesetzt hatte (
"Patents and Power", in: Technology and Culture, Vol. 48 (2007), Nr. 4, pp. 689 ff.) unterstrich in ihrem ausführlichen Kommentar, dass manche Patente (gateway patents) besonders wirkungsvoll seien („some patents have extra powers“), da sie den Zugang zur öffentlichen Domäne regulierten. Dies sei z. B. beim Telegrafen, wie Israel deutlich gemacht habe, der Fall: die Datenübertragung per Elektrizität könnte zwar durch das Patentrecht nicht geschützt werden und damit theoretisch für jedermann offen, aber die Rechte der Western Union am Telegrafen nebst aller seiner technischen Variationen führte faktisch trotzdem zu einem Zugang nur über deren Telegrafenstationen (und damit zu einem Monopol). Es zeige sich hier deutlich, dass das Patentsystem v. a. Einkommensquellen für Financiers durch die Ideen Dritter erschließe. Gerade heute zeigten internationale Handelsabkommen (und Handelskonflikte, siehe China), dass I.P.-Regimes mitverantwortlich für die Welt-Einkommensunterschiede sind. Als Ergebnis stand die Übereinkunft, dass das Patentsystem nicht als ein Indikator für die Technikentwicklung betrachtet werden könne, sondern dass auch vielmehr beachtet werden müsse, welche ökonomischen benefits durch I.P.-Schutzregimes entstehen, und wer von diesen profitiere, um die Verbindungen zwischen Innovationen und Recht besser zu verstehen.
jmueske - 6. Nov, 18:23

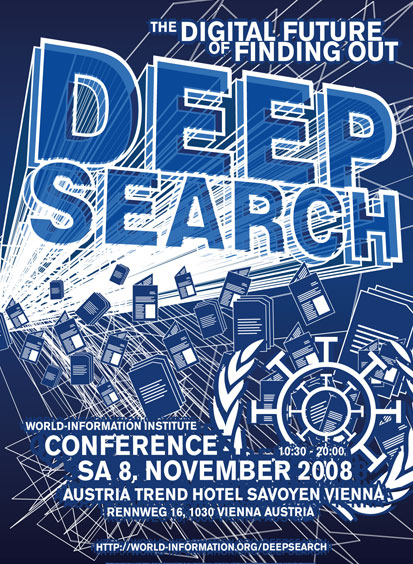
 Wenn in der aktuellen Ausgabe der
Wenn in der aktuellen Ausgabe der 














