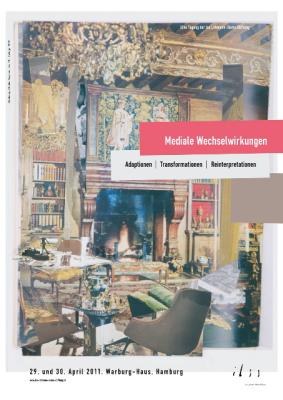Im Zentrum der interdisziplinären Tagung steht die Frage nach den Wechselwirkungen, die im Mit- und Nebeneinander verschiedener Medien entstehen.
Anhand von Beispielen, die von der Traumpraxis im japanischen Mittelalter über die Anfertigung von Manuskripten im Zeitalter des Buchdrucks in Nordeuropa bis hin zur Rolle des Radios in Benin reichen, wird die Dynamik verschiedener intermedialer Konstellationen wie Medienwechsel, Mediensynthesen und -hybride untersucht. Was geschieht, wenn zwei Medien sich ergänzen oder im Gegenteil einander unterlaufen? Lassen sich die Ausdrucksmöglichkeiten eines Mediums in ein anderes übersetzen? Verändert sich durch die Kombination eines Mediums mit einem anderen seine Artikulationskraft? Fragen wie diese eröffnen nicht nur Perspektiven auf die bedeutungs- und deutungsbildende Rolle von Medien, sondern führen auch zu der grundsätzlicheren Frage nach dem, was es ist, das ein Medium zum Medium macht.
Das Programm der Tagung:
Freitag 29.4.2011:
13:30 Begrüßung
14:00 Eröffnungsvortrag
Prof. Dr. Knut Hickethier (Medienwissenschaft):
Mediale Wechselwirkungen –
Modelle des medialen Zusammenwirkens
15:00 Dr. Wolfgang Kesselheim (Linguistik):
Die Museumsausstellung als hybrides Medium:
Formen intra- und intermedialer Verknüpfung
15:45 Kaffee
16:15 Dr. Matthias Bruhn (Kunstgeschichte):
Bild-Erwartungsflächen
17:00 Dr. Andreas Stuhlmann (Medienwissenschaft):
Glanz und Elend des Plagiats.
Eine Kulturtechnik in medialen Wechselwirkungen
17:45 Kaffee
18:15 Abendvortrag
Prof. Dr. Jörg B. Quenzer (Japanologie):
Traumwelten: Zur Medialität des Traums
im japanischen Mittelalter
Anschließend Wein & Brezeln
Samstag, 30.4.2011:
10:00 Christine Oldörp (Volkskunde):
Verdauerung, Verschriftlichung, Verfestigung
und Verselbstständigung.
Mündliches Sprechen im Spannungsfeld von
Mündlichkeit und Schriftlichkeit
10:45 Dr. Tilo Grätz (Ethnologie):
Karrieren, Dramen & Debatten.
Aspekte des Medienwandels in Benin (Westafrika)
11:30 Kaffee
12:00 Dr. Iris Höger (Kunstgeschichte):
Handschriften in der Frühzeit des Drucks.
Margarethe von Savoyen und die
»Werkstatt des Ludwig Henfflin«
12:45 Jan von Brevern (Kunstgeschichte):
Fotografie, Lupe, Teleskop und Bleistift.
Vom Sichtbarwerden fotografischer Gegenstände
13:30 Buffet
14:30 Dr. Susanne Warda (Germanistik):
Bild ohne Text. Monomedialität als Sinnreduktion
am Beispiel von Totentänzen
15:15 Hanna Wimmer (Kunstgeschichte):
Pictura, figura und Text im »Breviculum«
des Thomas Le Myésier
Anschließend Ausklang bei Kaffee
Anmeldungen zur Tagung sind auf der Seite der
Isa Lohmann-Siems Stiftung möglich.
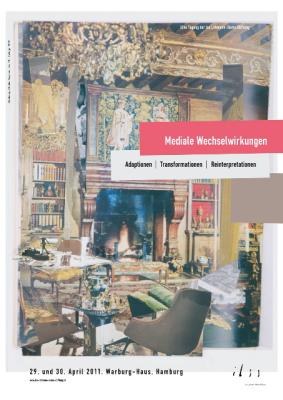
amischerikow - 15. Apr, 17:44